Schickt Tönnies nach Gulbarien

Ich hatte die Tage einen echt verrückten Traum. Denn ich träumte von Clemens Tönnies. Fast schon gruselig. Das Komische war nur, dass Tönnies zwar wie Tönnies aussah, wie Tönnies sprach, aber irgendwie nicht Tönnies war, denn der Kerl in meinem Traum war weder Fleischfabrikant noch Schalke-Boss. Er war bettelarm. Wie gesagt ein verrückter Traum.
Dieser Clemens Tönnies wusste also kaum, wie er Tag für Tag über die Runden kam. Es gab keine Arbeit für ihn und wenn, dann war sie richtig mies bezahlt. Ein Freund schwärmte ihm von einem Land vor, das gar nicht so weit weg war. In diesem Land, nennen wir es Gulbarien, lebten die Menschen im Überfluss. Männer wie er konnten dort das Vier- bis Fünffache von dem üblichen Salär verdienen.
Dafür musste man nur in einer großen, neuen, modernen Fabrik mit einem elektrischen Messer Fleisch von gerade geschlachteten Tieren zuschneiden. Den Menschen dort war die Arbeit zu anstrengend, die Fabrikbesitzer fanden kaum noch Arbeiter, weshalb sie gerne Menschen wie Tönnies willkommen hießen und einstellten.
Die Geschichte klang für Tönnies toll. Die Wohnung wurde gestellt, die Arbeitskleidung, ja auch um das Werkzeug musste man sich nicht kümmern, Und das Schöne war: Eine Firma organisierte den ganzen Transport dorthin, die Papiere. Er musste sich um nichts kümmern und könnte nach sechs Monaten mit Taschen voller Geld nach Hause kommen. Denn in diesem Land lief die Bezahlung sehr korrekt ab. Es gab dort einen Mindestlohn, Gesetze zum Schutz der Arbeiter. Das Land galt als eines der fortschrittlichsten in der Welt. Da musste man keine Angst haben, dass es nicht mit rechten Dingen zugehen würde. Schließlich gab es dort eine funktionierende Justiz und Arbeiterrechte, die respektiert wurden. Es war ein sehr reiches Land.
Clemens Tönnies ging also zu einer Adresse in seiner Stadt, unterschrieb einen Haufen Papiere, von denen er kaum was verstand und fuhr zwei Wochen später in einem Bus, den er noch nicht mal bezahlen musste, mit 60 anderen Männern los. Die Fahrt dauerte 25 Stunden, aber er konnte kaum schlafen, so aufgeregt war er.
Der Bus kam in der Nacht an und er war ganz gespannt, wie seine Wohnung aussehen würde. Die meisten Männer stiegen mit ihm aus. Er wurde in eine Wohnung gerufen und sah sich um: Drei verdreckte Zimmer, ein kleines heruntergekommenes Bad mit WC, eine schäbige Küche und sieben andere Männer, die mit ihm in der Wohnung standen. Ihm wurde ein Zimmer zugeteilt, das er sich mit zwei anderen teilen sollte. Sein Bett war eine alte ausgeklappte Wohnzimmercouch. Das Zimmer war mit den drei Schlafmöglichkeiten zugestellt. Immerhin hatte er einen schmalen Spind zur Verfügung, wo er seine Sachen einräumen konnte. Er war hundemüde, konnte aber nicht schlafen, weil die beiden anderen Männer nach Schweiß rochen und so laut schnarchten.
Am nächsten Tag wurden die Männer abgeholt. Ein Mann, der die Sprache von Tönnies sprach aber auch die Sprache der Gulbaren, erklärte ihnen auf dem Weg zur Arbeit die Abläufe in der Fabrik. Er machte ihnen deutlich, dass sie sich auf dem Weg durch die Fabrik zu den Umkleiden und dann in die Fließbandhallen zu beeilen hätten, da ihre Bezahlung erst am Fließband beginnen würde. Sie seien selbstständige Unternehmer, keine Angestellten. Die Firma müsse nur für die geleistete Arbeit aufkommen.
Tönnies fand das nicht fair, doch schlucken musste er erst recht, als ihm Schlachtmesser, Kleidung und Kopfbedeckung ausgehändigt wurden. Er musste die Arbeitsutensilien monatlich mieten, das Geld wurde ihm direkt vom Lohn abgezogen.
Er ging in die Halle mit den Fließbändern. Es war laut, eiskalt und dunkel. Tönnies trug ein rotes Haarnetz, die wenigen Gulbaren trugen weiße Kopfbedeckungen, sie waren festangestellt und waren in Leitungsfunktionen. Es gab auch Menschen aus anderen fremden Ländern mit gelben Netzen, die arbeiteten aber am Schinkenband.
An diesem ersten Arbeitstag stand Tönnies 12 Stunden am Fließband. Seine Aufgabe bestand darin die Beinscheiben von Rindern abzutrennen. Die Schicht dauerte ewig, er hatte lediglich einmal eine Pause von 20 Minuten. Als er mit dem Bus wieder in seine Unterkunft fuhr tat ihm der ganze Körper weh. Er hatte Schürfwunden und Schwielen an den Händen. Er legte sich sofort ins Bett und schlief ein.
Diese Tage wiederholten sich. Mal arbeitete er 13 Stunden, mal 17 Stunden. Sechs Tage in der Woche. Manchmal lagen nur neun Stunden zwischen den Arbeitseinsätzen. Nur sonntags war frei. Die Schichten waren mörderisch. Tönnies wurde oft nachts geweckt, um in die Fabrik zu fahren, wo er dann ab 3 Uhr morgens Fleisch zerschnitt. Er ging nur noch selten nach draußen. In der gulbarischen Kleinstadt fühlte er sich nicht wohl. Er verstand nichts und die Menschen dort schauten ihn abschätzig und teilweise auch böse an. Vielleicht weil man ihm seine Armut auch ansah.
Nach einer Woche sagte ihm sein Dolmetscher, dass er ab sofort die Beinscheiben nicht nur abzutrennen habe, sondern auch zerschneiden müsse. Aber das in der gleichen Zeit wie zuvor. „Wie soll das gehen?“, fragte er. „Das schaffe ich nicht.“ Der Mann ließ keine Widerrede zu. „Wo kann ich mich beschweren“, fragte Tönnies. Der Mann schaute ihn ernst an. „Wenn du das tust, fliegst du augenblicklich raus und bekommst auch kein Geld für die bisherige Arbeit.“ Tönnies schwieg ab da und arbeitete noch härter.
Die Arbeit war sehr gefährlich. Jede Woche verletzten sich Männer. Auch einer seiner Zimmerkollegen lag irgendwann mit einem abgeschnittenen Finger im Bett. Er jammerte, denn er erhielt kein Geld, wenn er nicht arbeitete dazu zog man ihm mehr Geld für die Unterkunft ab. Tönnies konnte es nicht glauben. Wie kann man so mit Menschen umgehen? Das ist doch ein reiches Land, dachte sich Tönnies.
In der Wohnung stapelte sich der Müll, es stank nach Essensresten, Schweiß und alten Möbeln. Manche Männer blieben länger, andere verschwanden nach einigen Wochen.
Tönnies hielt es kaum noch aus. Aber er wusste ja, warum er das tat. Mit dem Geld wollte er sich was aufbauen. Der Schock kam mit der ersten Abrechnung. Die Nachtzuschläge fehlten, auch stimmten die Stundenabrechnungen vorne und hinten nicht, Anfahrt, Pausen, das Umkleiden, ja selbst das Messerschärfen wurden nicht als Arbeitszeit berechnet, dazu schmälerten der Abzug der Zimmermiete, das Ausleihen der Arbeitskleidung und deren Reinigung deutlich den Lohn. Hochgerechnet kam er noch nicht einmal auf fünf Euro pro Stunde. Und das für diese Knochenarbeit. Ein Hungerlohn.
Tönnies war fassungslos. Er dachte: „Das ist doch moderne Sklaverei.“ Er wollte das nicht mehr mitmachen. Er diskutierte mit den anderen Männern in der Wohnung, sagte, wie ungerecht das alles sei. Sie gaben ihm alle Recht. Angetrieben davon beschwerte er sich bei seinem Dolmetscher.
Am nächsten Tag bekam er Besuch von der Firma, die ihm den Job vermittelt hatte. Ein Landsmann legte ihm ein Schreiben auf unverständlichem Gulbarisch vor, das er unterschreiben sollte. Tönnies tat wie ihm geheißen. Danach sagte ihm der Mann, dass er keinen Job mehr habe. Man bringe ihn zurück, weil er die anderen aufwiegeln würde und nicht gut sei bei seiner Arbeit.
Tönnies war empört und sagte, so einfach gehe das nicht, er habe schließlich einen regulären Arbeitsvertrag unterzeichnet. „Ja, aber gerade eben hast du deinen eigenen Auflösungsvertrag unterzeichnet“, sagte der Mann, der ihm beim Rausgehen noch zurief: „Morgen um sieben Uhr geht dein Bus….“
Es war der Moment, als ich aufwachte.
Clemens Tönnies als ausgebeuteter Werkvertragsarbeiter – was für ein Alptraum… Doch für zigtausende Osteuropäer in diesem Land leider bittere Realität.
Wir brauchen nicht mit dem Finger auf Katar zu zeigen, was die Arbeitsbedingungen der Werkarbeiter angeht; wir sollten erst einmal die menschenunwürdigen Zustände für viele Arbeiter in unserem Land verändern. Gut, dass sich da nun was tut.
Und vielleicht sollte Clemens Tönnies tatsächlich mal einen Monat in einer dieser schäbigen Unterkünfte wohnen, sollte von einem dieser Subunternehmen, mit denen er seit Jahren zusammenarbeitet, ausgebeutet werden, um am eigenen Leib zu spüren, welch perfides System er in all den Jahren aufgebaut hat. Schickt Tönnies nach Gulbarien, das wäre doch mal was, sagt ein nachdenklicher Mounir.*
*alle Einzelheiten aus dieser Geschichte sind nach Erzählungen und Beschreibungen von Werkarbeitern so in Deutschland passiert

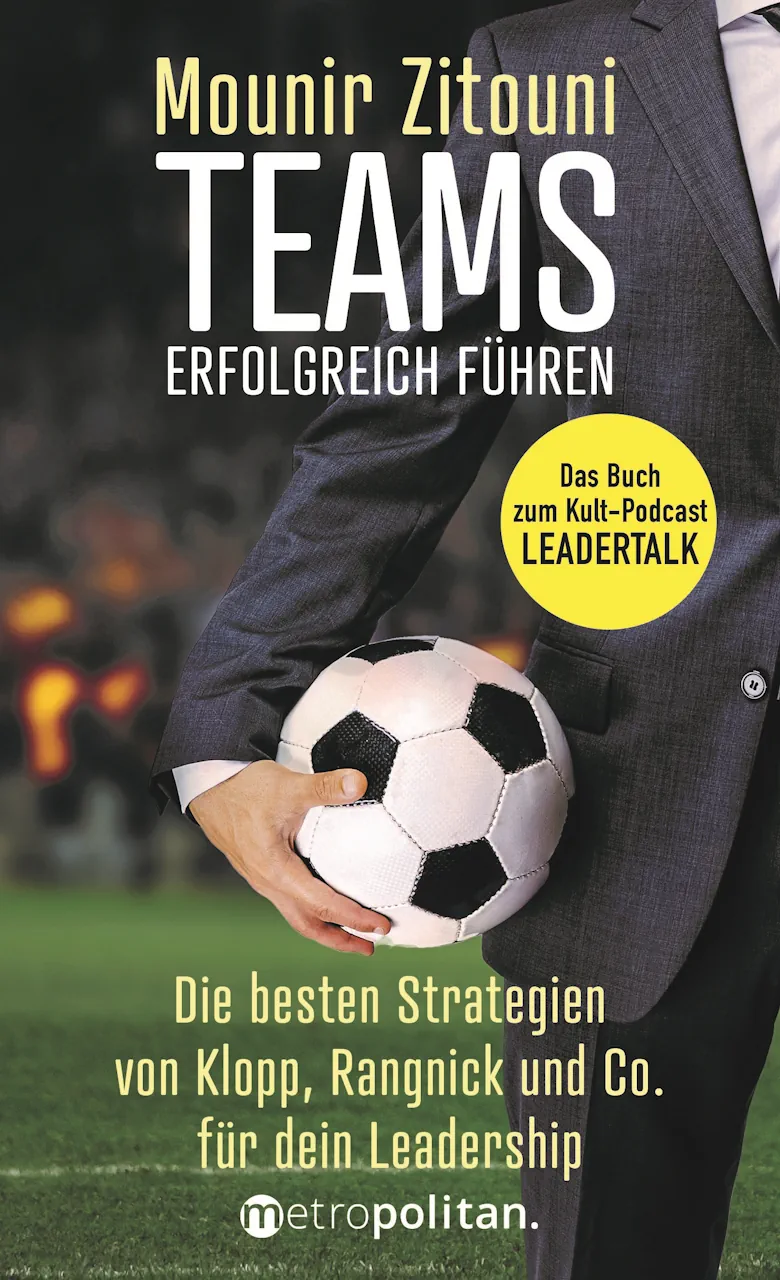
Man kann diese Tuesday-Posts nicht von hier aus einfach per Klick auf FB teilen, oder?
#Sklavenhalterunteruns…. niemand kann mir weismachen, dass Justiz und Politiker von diesen Machenschaften nichts wissen. Niemand. Und, wie gesagt, Tönnies ist nicht „nur“ Millionär, sondern Milliadär! Schalke 04 hat damit überhaupt kein Problem, kennt keine moralischen Skrupel, überall geht es nur noch um GeldGeldGeld.
Ich frage mich, ob es einen Zeitpunkt gab, den ich nicht bewusst mitgekriegt habe, dass diese krasse Geldgier auf Kosten der allerersten ethischen „Grundgesetze“ sozusagen derartig ins Nicht-mehr-Tragbare gekippt ist. Ich erinnere mich allerdings gut an die Warnungen der Globalisierungsgegner, sie haben diese Entwicklungen vorausgesagt. Jetzt kann der Betrieb sogar wieder öffnen und weiter Fleisch aus Massentierhaltung zerlegen.
Es ist nicht nur, dass all diese ethischen Fehltritte überhaupt so passieren können (siehe ersten Satz oben), sondern dass die Reaktion darauf vonseiten der Gesellschaft und ihrer Systeme nicht adäquat sind. Es kommt ein kurzer medialer Aufschrei und? Verpufft wieder. Deswegen: Gut, dass Du den Finger in dieses Wespennest steckst. Ich weiß nicht, was es noch braucht? Mehr Finger? Dabei sagen und tun und schreiben es doch schon so viele gute Journalisten. Allein: Es passiert zu wenig..