Die Corona-Krise: Schau mit den Augen eines Neugeborenen

Ich erzähle euch nun eine Geschichte.
Es geht um einen Mann, nicht alt, nicht jung, der allein und zurückgezogen in einem entfernten Winkel im Süden Deutschlands lebt. Es könnte auch der Norden sein, aber das tut nichts zur Sache. Der Mann wohnt in einem alten Jagdhaus, fernab von Ortschaften und Städten. Er ist kein Eigenbrötler, aber er mag die Ruhe und Abgeschiedenheit. Es ist der 20. März 2020 und der Mann, ein weitgereister Mensch, dessen Name hier nicht interessiert, verfolgt gebannt alle Entwicklungen rund um die Pandemie, die die Welt im Griff hat.
Die Ereignisse halten ihn in Schach. Er liest die Zeitungen, schaut alle Nachrichten, hört parallel auch Radio, um ja nichts zu verpassen. Er macht sich mehr und mehr Sorgen. In Deutschland gibt es an jenem Tag im März schon 68 Todesfälle. Sicher, nichts im Vergleich zu Italien, wo man an jenem 20. März bereits über 4000 Tote zählt. Aber dennoch. Das alles macht ihm Angst.
Was steht unserem Land noch bevor, fragt er sich verzagt? In Spanien, wo es nur wenig mehr Infizierte gibt, sind es schon 1000 Tote; die Krankenhäuser dort sind mancherorts überlastet, liest er. Das kommt sicher auch bald auf uns zu, denkt er. Gaststätten Restaurants, Cafes müssen in Deutschland gerade schließen, die Bundesliga setzt aus, Versammlungen mit mehr als fünf Personen sind nicht gestattet, die EU verhängt einen Einreisestopp, Kitas, Unis, Schulen sind zu und 160 000 deutsche Urlauber werden aus der Welt nach Hause geflogen. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht von einer „Herausforderung historischen Ausmaßes“ und der Mann hat das Gefühl, dass sie recht hat.
Der Besorgte, dessen Eltern leider nicht mehr leben, fragt sich: Wie werden nur die Alten, die Kranken, die Menschen mit Vorerkrankungen diese Krise überleben können? Der neue Virus tötet doch so schnell. Zwei Tage zuvor, am 18. März, hatte Merkel in einer Rede gesagt: „Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand. Wir können jetzt, entschlossen, alle miteinander reagieren. Wir können die aktuellen Einschränkungen annehmen und einander beistehen.“
Der Mann hört das und schüttelt den Kopf: Wie soll das gehen? Er hat kein gutes Bild dieser Gesellschaft, in der für ihn jeder nur an sich denkt, die meisten Menschen kein Mitgefühl mehr zeigen und schon gar keine Opfer für die Gemeinschaft bringen. Er befürchtet das Allerschlimmste. Und das tun die Experten an jenem 20. März auch. „Wir hoffen, dass es nicht so wie in Italien verläuft“, hört er von Politikern. „Die Zahlen werden weiter rapide steigen“, sagen Virologen. Und Ärzte verkünden: „Personal und Apparate reichen nicht für das, was jetzt kommt.“
Dem Mann graut es. Er hält es nicht mehr aus. Nicht die Bilder aus Italien, Spanien und den USA, nicht die steigenden Fallzahlen in Deutschland. An jenem 20. März hat er endgültig die Hoffnung verloren, dass die Krise doch nur eine kleine Krise ist und die Vorstellung, dass Deutschland allein in den nächsten vier Wochen bei dem weiteren kontinuierlichen Anstieg der Infektionszahlen zwischen zehn- und 15 000 Corona-Toten zählen wird, lässt ihn Ohnmacht spüren. Er würde sich so sehr wünschen, dass die Zahlen überschaubar bleiben, dass Verhältnisse wie in den USA, Italien ausbleiben. Aber die Hoffnung schwindet. Der verzweifelte Mann fällt im März einen Entschluss: Er taucht ab. Er macht sein Handy aus, schaltet den PC ab. Der Mann ist genügsam, hat genügend Lebensmittel für einen ganzen Monat. Er steigt aus. Kaum vorstellbar, aber er tut es. Er bekommt nichts mit, füttert nur seine Tiere, liest in alten Büchern, schreibt an einem Roman.
Bis zum gestrigen 20. April – dann hält er es nicht mehr aus. Die Tageszeitungen stapeln sich nach einem Monat am Tor zur Einfahrt, er schließt wieder den Fernseher an, stöpselt den Stecker des Radios ein. Erst traut er sich nicht, doch dann nimmt er die Zeitung zur Hand, schaltet den Fernseher ein. Und was hört und liest er: 150 000 Infizierte! Er rechnet hoch: vor einem Monat hatte Italien 47 000 Infizierte und 4000 Tote. Könnte heißen, dass Deutschland bereits 12 000, 13 000 Tote zu beklagen hat. Doch was erfährt er: Es sind 4700!
Auch was er sonst an diesem April-Montag aufsaugt gibt ihm das Gefühl, dass es in Deutschland im Vergleich zur Welt noch ganz glimpflich aussieht. Er liest von landesweiter Solidarität, die Menschen halten sich weitgehend an die Kontaktsperren, das Land unterstützt die Bürger und Unternehmen mit unglaublichen 1,2 Billionen Euro an Hilfen.
Der Mann ist aufgeregt, ruft seinen besten Freund an, muss seine Eindrücke mit jemanden teilen. Er sprudelt in einem fort: „Mensch, das läuft ja alles relativ gut“, sagt er. „Der Reproduktionsfaktor ist auf 0,7 gefallen, dabei war er Anfang März noch bei 6. Und die Zeit, in denen sich die Zahl der Infizierten verdoppelt, liegt mittlerweile bei 17, 6 Tagen. Mann, erinnerst du dich?“,ruft er ins Telefon. „Zu Beginn lag diese Zahl bei zwei Tagen. Bei zwei! Von wegen, das Gesundheitssystem ist zusammengebrochen, haha, wir haben echt was geschafft. Denn wir haben immer noch 12 000 freie Intensivbetten, dazu sind von den 1,8 Millionen Corona-Tests mittlerweile nur noch 8 Prozent positiv. Das heißt, dass die Ausbreitung stagniert. Alles viel besser als gedacht und dann die ganzen Hilfen. Wir können echt stolz sein, was wir gerade schaffen“, ruft er aus. Am anderen Ende Stille. „Hallo?“ Da merkt er: Sein Freund hat aufgelegt.
Der Mann wundert sich und loggt sich in seinen Computer ein. Er muss seine Überraschung, seine Freude, dass das Land die Krise bisher so gut gemeistert hat, teilen. Aber egal, mit wem er darüber chatten will, alle winken ab. Er tippt und tippt. Fragt: „Ja, wisst Ihr denn nicht, was wir vor vier Wochen für Ängste hatten. Sehr Ihr nicht, was wir alles hinbekommen haben?“ Doch die Bekannten und Freund reagieren nur mit Wut, Ärger und Hass. Er kapiert es nicht: „Aber das System läuft nur so gut, weil die Maßnahmen alle eingehalten wurden.“ Träumer, Spinner wird er betitelt. Er habe keine Ahnung. Das alles sei gar nicht so schlimm gewesen. Eine große Veralberei, sei das. Die Zahlen seien nie anders gewesen. Dass es jetzt so aussehe zeige, dass es gar keinen neuen Virus gebe.
Der Mann ist sprachlos. Da sind doch die 160 000 Tote weltweit. „Es hätte doch anders kommen können bei uns, ja, das war sogar wahrscheinlich, warum seht Ihr das nicht?“, fragt er in Großbuchstaben. Keine Antwort.
Der Mann versteht die Welt nicht. Gewöhnen sich die Menschen so schnell an das Erreichte, das Gute und Positive? Ist die Gewohnheit also doch der Feind Nummer eins des Glücks? Er kann es nicht glauben. Er geht in die Bibliothek und sucht in seinen Büchern, er wälzt Seite um Seite, um eine Antwort zu finden. Und dann steht der Satz da, den er gesucht hat und den er gern all denen zurufen würde, die heute mit griesgrämigen Gesicht über die aktuellen Erfolge im Kampf gegen die Pandemie schimpfen. Und das, obwohl das Land es geschafft hat, tausende von Menschen nicht sterben zu lassen. Ja, und wenn es nur ein Mensch wäre. Wer würde entscheiden, ja lasst ihn sterben, damit es mir dadurch besser ginge? Wer?
Er sieht den Satz und liest ihn laut vor: „Wenn du auf dem Weg bist, Gewohntes als dein Unglück zu empfinden, dann schau einfach mit neuen Augen hin – wie ein Ungeborenes, das die Welt entdeckt.“
Ja, das ist in der Tat manchmal ein schöner Weg, das Glück, das die ganze Zeit neben dir läuft, zu erkennen und zu umarmen, probiert es aus, sagt ein nachdenklicher Mounir.

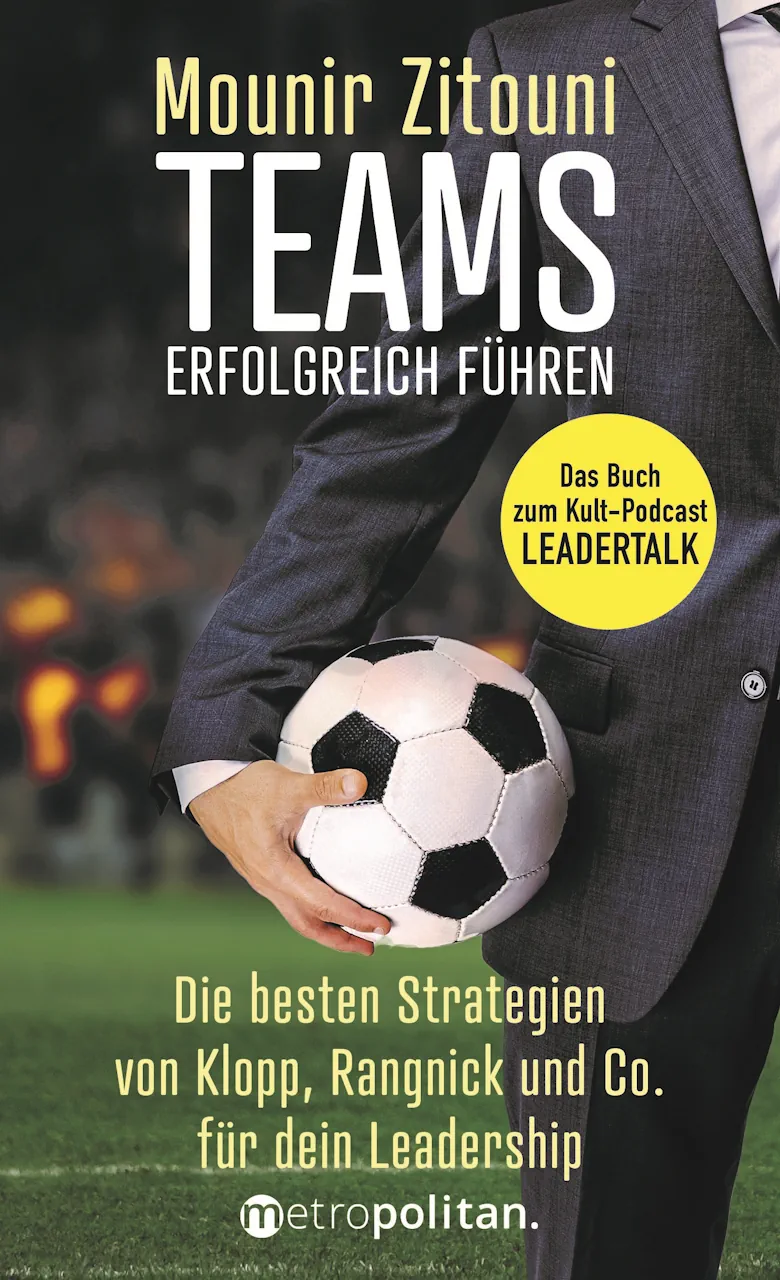
Großartig! Danke, Danke, Danke!
Von Herz zu Herz….ich bin berührt….
Lieber Mounir,
vielen lieben DANK für die so schöne Geschichte, sehr berührend…………………..
Herzliche Grüße
Ewald
Danke dir! Fürs lesen, für deine Werte und Überzeugungen, die du seit Jahren lebst. Ein echtes Vorbild nenne ich dich…